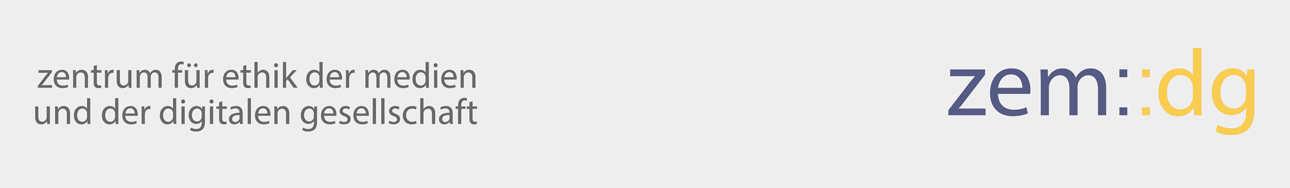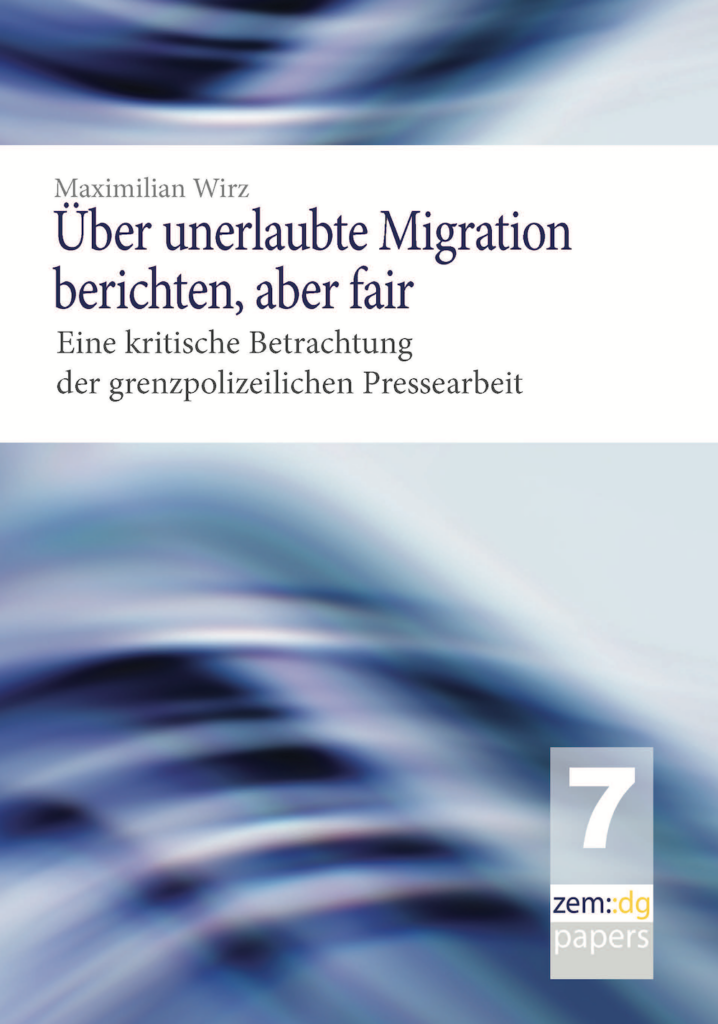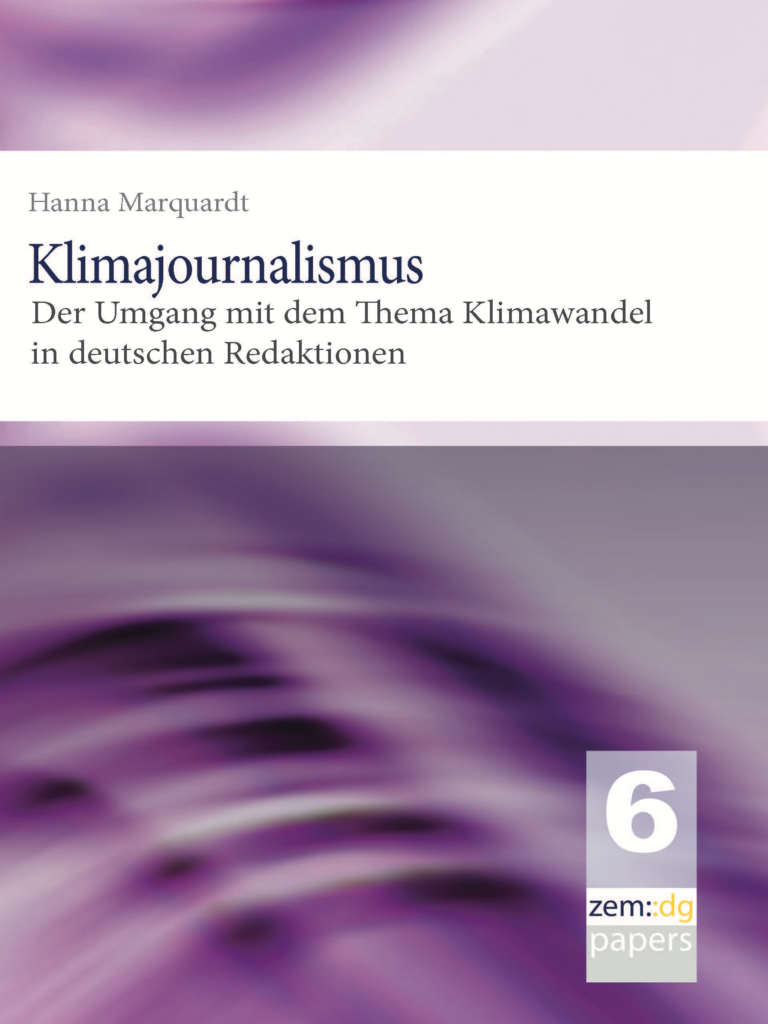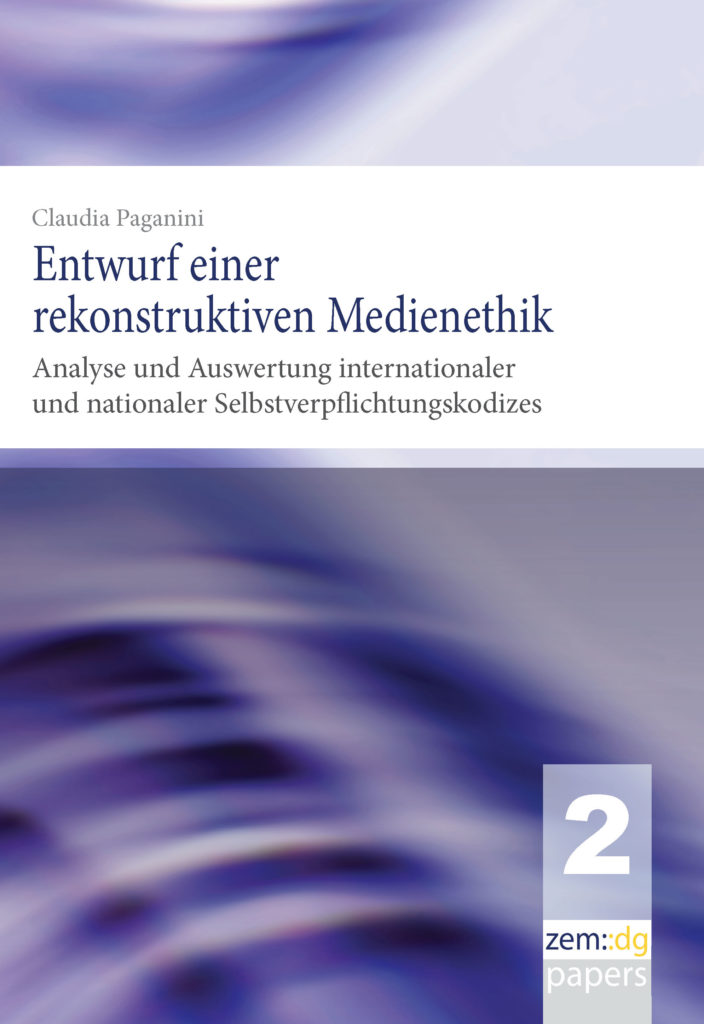In unserer Reihe „zem::dg-papers“ veröffentlichen wir ausgezeichnete Abschlussarbeiten (wie beispielsweise Masterarbeiten, Dissertationen oder Habilitationen) aus dem Bereich der Medienethik. Die Reihe wird von der Leitung des zem::dg herausgegeben. Die einzelnen Bände stehen alle unter Open Access und können über die Plattform KU.edoc heruntergeladen werden.
Die einzelnen Bände der Reihe erscheinen zusätzlich auch in einer geringen Auflage in Printform.
Maximilian Wirz
Über unerlaubte Migration berichten, aber fair
Eine kritische Betrachtung der grenzpolizeilichen Pressearbeit
Kurzzusammenfassung:
Der Umgang der deutschen Gesellschaft mit irregulärer Migration war in den vergangenen Jahren durchaus ambivalent. Prägte im Herbst 2015 zunächst die medial zelebrierte Willkommenskultur gegenüber Kriegsflüchtlingen die Schlagzeilen, waren nach kurzer Zeit zunehmend kritische Tendenzen an diversen Begriffen ablesbar, die eben jene schutzsuchenden Menschen metaphorisch als bedrohliche Naturkatastrophen beschrieben. Spätestens als die Bundesregierung die Polizeipräsenz im Grenzgebiet zu Österreich signifikant erhöhte, wurden die für den Grenzschutz zuständigen Polizeidienststellen Teil dieses konfliktträchtigen Diskurses.
Nicht zuletzt angesichts der oft schwierigen persönlichen Umstände irregulär migrierender Menschen stellt sich die Frage, wie die Polizei angemessen und empathisch über unerlaubte Grenzübertritte informieren kann. Die vorliegende Masterarbeit bietet hierfür sechs praxisorientierte Grundsätze an, die angewendet und fortentwickelt werden wollen. Als deren normative Grundlage wählte der Verfasser Claudia Paganinis Entwurf einer rekonstruktiven Medienethik.
Wirz, Maximilian (2023): Über unerlaubte Migration berichten, aber fair. München, Eichstätt (zem::dg-papers, 7).
ISBN (print) 978-3-947443-16-1
ISBN (digital) 978-3-947443-17-8
Hanna Marquardt
Klimajournalismus
Der Umgang mit dem Thema Klimawandel in deutschen Redaktionen
Kurzzusammenfassung:
Eine der fundamentalsten Herausforderungen unserer Zeit: der Klimawandel. Auch die Medien spielen in der Auseinandersetzung damit und der Behandlung dessen eine entscheidende Rolle, weil sie Wirklichkeit konstruieren. Doch die derzeitige Klimaberichterstattung wird kritisiert. Die vorliegende Arbeit analysiert den Umgang mit dem Thema Klimawandel in Redaktionen verschiedener deutscher Leitmedien und soll damit zur Grundlagenschaffung eines besseren Verständnisses in diesem Bereich beitragen. Mittels einer Interviewstudie werden Produktionsprozesse von Klimaberichterstattung und damit einhergehende Probleme sowie Veränderungen und Ideen zu zukünftigem Klimajournalismus in den Blick genommen und diskutiert. Dabei wird die Komplexität dessen aufgezeigt und angedeutet, welchen fundamentalen Fragen sich der Journalismus in diesem Zusammenhang stellen sollte.
Marquardt, Hanna (2023): Klimajournalismus. Der Umgang mit dem Thema Klimawandel in deutschen Redaktionen. München, Eichstätt (zem::dg-papers, 6).
ISBN (print) 978-3-947443-18-5
ISBN (digital) 978-3-947443-19-2
Hanna Marquardt
führte die vorliegende Studie 2022 als Masterarbeit im
Fach Journalistik mit Schwerpunkt Innovation und Management
durch. Im Bachelor studierte sie Kommunikationswissenschaft
an der Universität Hohenheim und
absolvierte davor und währenddessen mehrere Praktika
im Medienbereich. Den Master der Journalistik legte sie
anschließend an der Katholischen Universität Eichstätt-
Ingolstadt ab, wobei sie gleichzeitig noch das Zusatzstudium
Nachhaltige Entwicklung abschloss.
Barbara-Henrika Alfing
Äcker, Ähren, Agrarkritik
Eine kommunikationswissenschaftliche Studie zur medialen Darstellung von Krisen und krisenhaften Zuständen in der deutschen Landwirtschaft
Kurzzusammenfassung:
Alfing, Barbara-Henrika (2023): Äckern, Ähren, Agrarkritik. Eine kommunikationswissenschaftliche Studie zur medialen Darstellung von Krisen und krisenhaften Zuständen in der deutschen Landwirtschaft. München, Eichstätt (zem::dg-papers, 5).
ISBN (print) 978-3-947443-12-3
ISBN (digital) 978-3-947443-13-0
DOI 10.17904/ku.edoc.32271
Barbara-Henrika Alfing studierte Journalistik und Kommunikationswissenschaften in Eichstätt, Brüssel und Berlin. Sie wurde 2022 an der Katholischen Universität Eichstätt- Ingolstadt promoviert. Ihr Dissertationsprojekt wurde zudem durch ein Begabtenstipendium der Hanns- Seidel-Stiftung e. V. gefördert.
Hans Oechsner
Politische Interviews im Fernsehen
Medienethische Probleme von Inszenierungen
Kurzzusammenfassung:
Oechsner, Hans (2021): Politische Interviews im Fernsehen. Medienethische Probleme von Inszenierungen. München, Eichstätt (zem::dg-papers, 4).
ISBN (print) 978-3-947443-06-2
ISBN (digital) 978-3-947443-07-9
DOI: https://doi.org/10.17904/ku.edoc.28504
 Hans Oechsner arbeitete als Fernsehjournalist, war Autor, Filmemacher, Interviewer, Morderator und Auslandsreporter in Israel, im Kosovo, in der Türkei und in Italien. Er promovierte mit der vorliegenden Arbeit an der Hochschule für Philosophie München.
Hans Oechsner arbeitete als Fernsehjournalist, war Autor, Filmemacher, Interviewer, Morderator und Auslandsreporter in Israel, im Kosovo, in der Türkei und in Italien. Er promovierte mit der vorliegenden Arbeit an der Hochschule für Philosophie München.
Jeanne Jacobs
Livestreaming nach Gewalttaten
Ethische Grenzen journalistischer Berichterstattung
Kurzzusammenfassung:
schwierigen und akuten Situationen sofort und ohne aufwendige Technik möglich.
Angesichts dieser Veränderungen stellt sich aber die Frage: Sind die ethischen Leitperspektiven, die bisher grundlegend für die journalistische Berichterstattung waren, für das neue Livestreaming noch praktikabel?
Um diese Frage zu untersuchen, wurden für die vorliegende Arbeit sechs Journalistinnen und Journalisten interviewt, die mit dieser Form der Liveberichterstattung gearbeitet haben. Ihre Erfahrungen liefern neben der theoretischen Betrachtung ethischer Grundlagen journalistischer Liveberichterstattung Hinweise darauf, welche Herausforderungen Journalistinnen und Journalisten in Situationen nach Gewalttaten erwarten und wie sie diesen begegnen können.
Jeanne Jacobs (2019): Livestreaming nach Gewalttaten Ethische Grenzen journalistischer Berichterstattung. München, Eichstätt (zem::dg-papers, 3).
ISBN (print) 978-3-947443-04-8
ISBN (digital) 978-3-947443-05-5
DOI: https://doi.org/10.17904/ku.edoc.23167
Jeanne Jacobs arbeitet als stellvertretende Redaktionsleiterin in der Onlineredaktion der
Abendzeitung in München. Sie hat Politische Wissenschaft in München
und Kopenhagen studiert und den berufsbegleitenden Masterstudiengang
Digital Journalism an der Hamburg Media School absolviert.
Claudia Paganini
Entwurf einer rekonstruktiven Medienethik
Analyse und Auswertung internationaler und nationaler Selbstverpflichtungskodizes
Kurzzusammenfassung:
Paganini, Claudia (2018): Entwurf einer rekonstruktiven Medienethik. Analyse und Auswertung internationaler und nationaler Selbstverpflichtungskodizes. München, Eichstätt (zem::dg-papers, 2).
ISBN (print) 978-3-947443-02-4
ISBN (digital) 978-3-947443-03-1
 Claudia Paganini ist Inhaberin der Professur für Medienethik an der Hochschule für Philosophie München. Sie hat Philosophie und Theologie an den Universitäten Innsbruck und Wien studiert. Nach einer Promotion in Kulturphilosophie 2005 widmete sie sich in ihrer Habilitationsschrift, für die sie 2018 mit dem Pater Johannes Schasching SJ-Preis ausgezeichnet wurde, der Medienethik. Zuvor hatte sie einige Jahre sowohl als Pressesprecherin als auch als Journalistin gearbeitet.
Weitere Forschungsschwerpunkte sind Medizin-, Tier- und Umweltethik. Während ihrer Tätigkeit an der Universität Innsbruck war Paganini als Gastdozentin an den Universitäten von Mailand, Athen, Zagreb und Limerick tätig. Sie ist Mitglied der Ethikkommission der Medizinischen Universität Innsbruck (MUI) sowie der Kommission für Tierversuchsangelegenheiten des österreichischen Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung in Wien. Außerdem ist sie in der interdisziplinären Lehre und in der Erwachsenenbildung engagiert.
Gemeinsam mit Klaus-Dieter Altmeppen leitet sie das zem::dg – Zentrum für Ethik der Medien und der digitalen Gesellschaft.
Claudia Paganini ist Inhaberin der Professur für Medienethik an der Hochschule für Philosophie München. Sie hat Philosophie und Theologie an den Universitäten Innsbruck und Wien studiert. Nach einer Promotion in Kulturphilosophie 2005 widmete sie sich in ihrer Habilitationsschrift, für die sie 2018 mit dem Pater Johannes Schasching SJ-Preis ausgezeichnet wurde, der Medienethik. Zuvor hatte sie einige Jahre sowohl als Pressesprecherin als auch als Journalistin gearbeitet.
Weitere Forschungsschwerpunkte sind Medizin-, Tier- und Umweltethik. Während ihrer Tätigkeit an der Universität Innsbruck war Paganini als Gastdozentin an den Universitäten von Mailand, Athen, Zagreb und Limerick tätig. Sie ist Mitglied der Ethikkommission der Medizinischen Universität Innsbruck (MUI) sowie der Kommission für Tierversuchsangelegenheiten des österreichischen Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung in Wien. Außerdem ist sie in der interdisziplinären Lehre und in der Erwachsenenbildung engagiert.
Gemeinsam mit Klaus-Dieter Altmeppen leitet sie das zem::dg – Zentrum für Ethik der Medien und der digitalen Gesellschaft.
Beyond the Bubble
The Digital Transformation of the Public Sphere
Kurzzusammenfassung:
Abstract, monolithic conceptions of the one coherent public appear outdated, since technological changes like the rise of social media, as well as the modern appreciation of individualism, human tendencies towards a confirmation bias, and the postcolonial focus on contextual experience have created or reinforced a diverse spectrum of filtered publics that do not fulfill the criteria associated with the public sphere. Can we even continue to use the term?
Bedford-Strohm, Jonas (2017): Beyond the Bubble. The Digital Transformation of the Public Sphere and the Future of Public Institutions. München, Eichstätt (zem::dg-papers, 1).
ISBN (print) 978-3-947443-00-0
ISBN (digital) 978-3-947443-01-7
 Jonas Bedford-Strohm ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Medienethik der Hochschule für Philosophie München und assoziierter Mitarbeiter am Zentrum für Ethik der Medien und der Digitalen Gesellschaft (zem::dg). Seine Forschungsinteressen konzentrieren sich auf den digitalen Strukturwandel der Öffentlichkeit und die ethischen Implikationen disruptiver Technologien. Er arbeitet neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit im Innovationsmanagement des Bayerischen Rundfunks, wo er Medien-Anwendungen für intelligente Sprachassistenten entwickelt.
Jonas Bedford-Strohm ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Medienethik der Hochschule für Philosophie München und assoziierter Mitarbeiter am Zentrum für Ethik der Medien und der Digitalen Gesellschaft (zem::dg). Seine Forschungsinteressen konzentrieren sich auf den digitalen Strukturwandel der Öffentlichkeit und die ethischen Implikationen disruptiver Technologien. Er arbeitet neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit im Innovationsmanagement des Bayerischen Rundfunks, wo er Medien-Anwendungen für intelligente Sprachassistenten entwickelt.
Jenseits der Blase: Der digitale Strukturwandel der Öffentlichkeit und die Zukunft öffentlicher Institutionen
Die Digitalisierung verändert die Art und Weise, wie wir kommunizieren, und hat dadurch auch weitreichende Implikationen für die Art und Weise, wie wir an dem Raum teilnehmen, den wir “öffentlich” nennen. Die vorliegende Studie untersucht den digitalen Strukturwandel der Öffentlichkeit und analysiert drei entwicklungstreibende Trends — Netzwerkarchitekturen, personalisierte Individualität und automatisierte Arbeitsabläufe — besonders im Hinblick auf Diskurs und Möglichkeit digitaler Handlungskompetenz.
Die Kernthese der Studie ist, dass sich abstrakte, monolithische Konzeptionen der einen kohärenten Öffentlichkeit überholt haben, weil technologische Veränderungen wie die Verbreitung sozialer Medien, die moderne Wertschätzung des Individualismus, menschliche Tendenzen zum Confirmation Bias, sowie das postkoloniale Interesse an kontextueller Erfahrung, ein diverses Spektrum an gefilterten Teilöffentlichkeiten hervorgebracht haben, die für sich allein genommen jeweils nicht die Kriterien erfüllen, die mit dem Konzept der Öffentlichkeit bisher assoziiert wurden. Sollten wir den Begriff überhaupt noch benutzen?
Indem sie Interkontextualität als Rückgrat des Öffentlichen und den Grad der Interkontextualität kontextueller Kommunikation als den Maßstab ihres Öffentlichkeitsgrades versteht, schlägt die Studie eine theoretische Schneise zwischen relativistischem Kontextualismus und abstraktem Universalismus. Sie plädiert für eine pragmatistische Spielart eines relationalen, interkontextuellen und kommunikativen Universalismus, der kontextuelle Erfahrung ernst nimmt und wertschätzt, aber den Fokus auf spezifische Kontexte nicht absolut setzt und nach dem Verbindenden fragt, das über die Blasen teil-öffentlicher Kommunikation hinausgeht.
Da der Diskurs über öffentliche Kommunikation maßgeblich von den institutionellen Formen der garantierten Freiheit der liberalen Demokratie beeinflusst wird, und diese selbst wiederum beeinflusst, interpretiert diese Studie den digitalen Strukturwandel der Öffentlichkeit als eine grundlegende Transformation der Bedingung für die Möglichkeit öffentlicher Institutionen. Sie bringt theoretische Erkenntnisse aus verschiedenen akademischen Disziplinen, sowie empirische Analysen des Vertrauens in Institutionen in Anschlag, um die Diskussionen der Ethik öffentlicher Institutionen im digitalen Zeitalter inhaltlich anzuregen und neu zu durchdenken.
Diese Studie richtet sich einerseits an die akademische Öffentlichkeiten der praktischen Philosophie, der politischen Theorie und der angewandten Ethik, und bereichert diese Diskurse mit theoretischen Analysen der journalistischen, politischen und technologischen Praxis, die durch ihren gesellschaftlichen Einfluss auch die theoretische Zunft zu einer Aktualisierung ihres Öffentlichkeitsbegriffs zwingen. Die Studie richtet sich andererseits aber auch an Führungskräfte in Politik, Wirtschaft, Medien, Kirchen und öffentlicher Verwaltung, die auf den je eigenen Gebieten in den je eigenen Kontexten auf eine ethisch auskunftsfähige Gestaltung der Digitalisierung drängen und aus der theoretischen Reflexion Orientierungswissen für ihre Arbeit gewinnen wollen.
Beyond the Bubble: The Digital Transformation of the Public Sphere and the Future of Public Institutions
The digital revolution changes the way we communicate, and thus has profound implications for how we participate in the space we call “public.” This thesis examines the digital transformation of the public sphere, and analyzes three trends driving the transformation — network architecture, personalized individuality, and automated workflows — in the context of the discourse on digital agency.
The core thesis of this study is that abstract, monolithic conceptions of the one coherent public are outdated, because technological changes like the rise of social media, the modern appreciations of individualism, human tendencies towards confirmation bias, and postcolonial interests in contextual experience, create a diverse spectrum of filtered publics that do not fulfill the criteria traditionally associated with the concept of the public sphere. Can we even continue to use the term?
By understanding intercontextuality as the backbone of the public sphere, and the degree of intercontextuality in contextual communication as the hallmark for its publicness, this study seeks to find a path between relativistic contextualism and abstract universalism. It advocates a pragmatist brand of relational, intercontextual, and communicative universalism that appreciates context, but does not absolutize it.
Finally, since the discourse on public communication significantly impacts and is impacted by the institutional forms of guaranteed freedoms in liberal democracies, this study interprets the digital transformation of the public sphere as a significant transformation of the conditions for the possibility of public institutions. It uses theoretical insights from a variety of academic disciplines, as well as empirical analysis of the trust in institutions to stimulate the discussion on the ethics of public institutions in the digital age.
This study is written for both theory and praxis. On one hand, it targets the academic publics of practical philosophy, political theory and applied ethics, and enriches their discourses with theoretical analysis of those journalistic, political and technological practices that force a conceptual update of the public sphere through sheer societal impact. On the other hand, this study also targets leaders in both the public and the private sector, as well as the (public) media, churches and civil society. The study is written for those leaders who work towards an ethically responsible digital transformation in their respective contexts and want to use theoretical reflection to distill orienting knowledge for their own work.